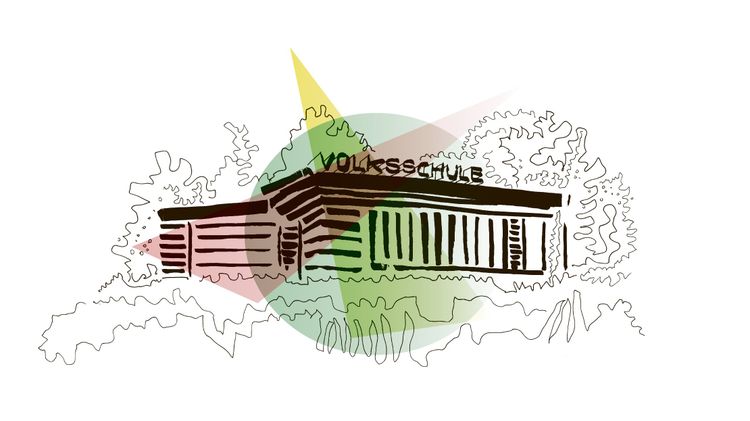
"Im Schnitt sitzt mindestens ein Kind pro Klasse in besonders gefragten Volksschulen in wohlhabenden Vierteln dank einer manipulierten Wohnadresse", schlussfolgert die Ökonomin Anita Zednik aus einer Analyse der Meldedaten.
Es war ein "Kampf" über mehr als zehn Jahre, erzählt Isabella Kirchmayr. So lange wartete die Direktorin der Volksschule in der Schulgasse 57 in Währing Jahr für Jahr mit ihren Lehrkräften beim "Tag der Wiener Schulen" auf Gäste – und niemand kam. "Unsere Schule galt als ganz klassische ,Ausländerschule‘, über die die Eltern in der Nachbarschaft sagten: Da kann mein Kind nicht hingehen."
Dann, vor zwölf Jahren, als der Standort Nachmittagsbetreuung einführte, tauchten plötzlich "ein, zwei Elternpaare" auf, die sich für die "Bunte Schule Währing" interessierten. Und im Vorjahr musste Kirchmayr zum ersten Mal das tun, was sie nie wollte: "Ich musste vier Kinder abweisen." Die Zahl der verfügbaren Plätze war plötzlich kleiner als die Zahl der Kinder, die bei ihr die ersten vier Schuljahre verbringen wollten. Dazwischen lagen "drei, vier, vielleicht fünf Jahre", die die Direktorin als "wunderbaren Zustand" beschreibt, "weil ziemlich genauso viele Kinder kamen, wie wir aufnehmen konnten".
700 Meter Luftlinie eine andere Schulwelt
Nur 700 Meter Luftlinie entfernt steht die Volksschule, die Michaela Judtmann seit zehn Jahren leitet. Das, was Isabella Kirchmayr erst im 19. Jahr ihrer Direktionszeit exekutieren musste, gehörte bei ihr von Anfang an dazu: Kindern bzw. ihren Eltern zu sagen, "Ihr dürft nicht zu uns. Für euch ist hier kein Platz." Denn die GTVS Köhlergasse 9, ebenfalls im 18. Bezirk situiert, ist eine jener Schulen, so raunen es Eltern einander zu, "in die alle wollen".
GTVS ist für viele Familien quasi der Goldstandard für Volksschulen: eine "echte" Ganztagsschule mit verschränktem Unterricht. Lernphasen, Freizeit, gemeinsames Essen und Hausübungsstunden sind über den Schultag, der für alle rund 230 Kinder von 8 bis 15.30 Uhr dauert, verteilt. Also "sehr begehrt, aber auch sehr schwierig", beschreibt die Direktorin das Dilemma, das beide Seiten betrifft. Eltern und Kinder, die abgewiesen werden, Direktorinnen, die abweisen müssen.
"Es ist die schiachste Zeit im Jahr, weil es fast ein bisschen wehtut, den Menschen eine Absage zu geben", sagt Judtmann, die in "guten" Jahren, wenn sie ressourcenbedingt drei erste Klassen eröffnen kann, drei bis vier Kinder wegschicken musste – in schlechteren, mit zwei Starterklassen, zehn bis 15. "Heuer habe ich hundert Anmeldungen, aber nur Platz für 75 Kinder." 25 Kinder zu viel.

Dieses zahlenmäßige Missverhältnis resultiert auch daraus, dass es in Wien keine Schulsprengel mehr gibt. Bis Ende 2017 waren der Wohnbezirk und die angrenzenden Gemeindebezirke ein Schulsprengel. Seit 2018 kann jedes Kind an jeder Volksschule eingeschrieben werden – wenngleich das nicht heißt, dass es dort auch einen Schulplatz bekommt. Es sei denn ...
Schulisches "Einzugsgebiet"
In Linz wurden bereits 2007 die 35 Volksschulsprengel – das rechtlich definierte Einzugsgebiet einer öffentlichen Pflichtschule – zu einem zusammengefasst. Graz, Klagenfurt und Eisenstadt haben ebenfalls nur einen flächendeckenden Sprengel. Hinter der Abschaffung der Schulsprengel stand in der Regel die Idee, Eltern mehr Wahlfreiheit, etwa für schulische Schwerpunkte, zu geben – was die Schulen in eine Wettbewerbssituation gebracht hat. Sie sollten möglichst "attraktiv" werden und sich "profilieren".
Im Normalfall – auf dem Land üblich – liegt die zuständige Pflichtschule in dem Bezirk, wo der Hauptwohnsitz des Kindes ist. "Umsprengelungen" müssen genehmigt werden. Ohne Sprengel entsteht eine Marktsituation, konkret ein "Matching-Markt" mit begrenzten Kapazitäten: Ich kann zwar wählen, aber ich muss auch ge- oder erwählt werden. Schulplätze gelten dabei wie etwa Spenderorgane als Märkte, wo Preise gesellschaftlich unerwünscht sind (zumindest im öffentlichen bzw. legalen Bereich). Also braucht man andere Zuteilungsmechanismen, die ohne Geld funktionieren.
Geschwisterbonus
Die offiziellen Auswahlkriterien sind bekannt: Geschwister an der Schule sind quasi ein fixes Eintrittsticket für die Jüngeren in der Familie. Und dann zählt vor allem die Wohnortnähe. In der Ganztagsschule von Michaela Judtmann müssen beide Eltern auch berufstätig sein. "Da fängt es schon an", erzählt sie: "Die, die in Karenz sind, sagen bei der Einschreibung im Jänner, sie fangen im Herbst eh wieder zu arbeiten an. Das muss ich dann glauben und eine Vorauswahl treffen." Letztlich entscheidet dann die für Schülerstromlenkung zuständige Präsidialabteilung 6 der Bildungsdirektion Wien, wer welchen Volksschulplatz bekommt.
Beide Direktorinnen sprechen offen aus, warum einige Schulen überlaufen sind und andere weniger Kinder als möglich haben: "So weh es mir tut", sagt Kirchmayr, die selbst Klassen unterrichtet hat, in denen von 20 Kindern 16 kein Deutsch konnten: "Wenn Eltern dort zu viele Kinder mit Migrationshintergrund vermuten, gehen sie lieber woanders hin." Das gelte auch für bildungsaffine, aufstiegsorientierte, mehrsprachige Eltern aus migrantischen Milieus. Sie reagierten darauf, "dass man Klassen so überfüllt mit Kindern, die nicht Deutsch können". Bei der Klasseneinteilung in ihrer bewusst als "bunt und gemischt" entwickelten Volksschule mit einem Englischschwerpunkt achtet sie daher ganz bewusst auf soziokulturelle Durchmischung.
Sprachumfeld für viele entscheidend
Auch Judtmann, die sich in ihrer Ganztagsvolksschule im 18. Bezirk "mehr Kinder mit Migrationshintergrund wünschen würde", sagt: "Es ist ja auch logisch, dass ein Kind mit mehr deutschsprachigen Kindern die Sprache besser lernt."
"Der Achtzehnte" ist, könnte man sagen, ein schulischer Battleground, auf dem exemplarisch zu beobachten ist, wie der "Schulmarkt" funktioniert. Sieben öffentlichen stehen dort acht private Volksschulen gegenüber. Was also tun, um in die Lieblingsschule zu kommen?
"Die meisten fragen, wo muss ich wohnen, damit ich zu Ihnen kann, wie viele Meter entfernt", erzählt Direktorin Judtmann. Es gibt Jahre, da können 700 Meter reichen, in anderen sind 501 schon zu viel, wenn zu viele innerhalb dieses Kreises daheim sind: "Das ist natürlich bitter." Dann haben einige Kinder plötzlich zwei Wohnsitze, sind im Büro der selbstständigen Eltern oder bei der Oma gemeldet. Was nicht passt, wird passend gemacht, und sei es durch eine illegale Aktion. Das Kind "wohnt" dann halt woanders.
Kinder mit Fake-Wohnsitz
Was anekdotisch viele kennen, kann Ökonomin Anita Zednik vom Institut für Märkte und Strategie der WU Wien mit Evidenz belegen. Sie konnte anhand der Analyse anonymisierter Meldedaten zeigen, dass es strategisches Elternverhalten gibt, um an den Wunschschulplatz zu kommen. Ummeldungen von Kindern steigen nämlich in den Altersgruppen sowie in den Monaten vor der Anmeldefrist sprunghaft an – nicht nur vor dem Wechsel ins begehrte Gymnasium, sondern auch schon vor Eintritt in die Volksschule. Nach ein paar Monaten, nach erfolgreicher Schulplatzzuweisung, werden dieselben Kinder wieder zurück an die ursprüngliche (Familien-)Adresse gemeldet.

"Das legt den Schluss nahe", erklärt Zednik, "dass im Schnitt mindestens ein Kind pro Klasse in besonders gefragten Volksschulen in wohlhabenden Vierteln dank einer manipulierten Wohnadresse sitzt. Das beeinflusst die komplexe Aufgabe der Zuteilung negativ, benachteiligt jene Eltern, die bei der Anmeldung ehrlich sind, und verstärkt die soziale Segregation in den Schulen, weil Menschen mit Migrationshintergrund oder weniger Bildung seltener so agieren. Die, die sich strategisch verhalten, profitieren."
Wie kann man dieses System gerechter und fairer machen? Indem man die Allokationsmechanismen verändert und "Zuteilungskriterien definiert, die politische Ziele abbilden", sagt Zednik: "Wenn man etwa sagt, dass es an einer Schule mindestens 20 und maximal 50 Prozent Migrationsanteil geben soll."
Die es sich richten können
Zedniks Kollege Ben Greiner, Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der WU, erklärt: "Solange die Distanz ein Kriterium ist, wird es Anreize geben, die Distanz zu überwinden." In den USA wurde der Druck durch strategisches Elternverhalten und Unzufriedenheit über Ungleichheit – exorbitant hohe Häuserpreise auf der Straßenseite in der Nähe von begehrten Schulen – irgendwann so groß, dass in vielen Städten zentrale Matching-Algorithmen eingeführt wurden. Eltern werden dort nach einer Reihung von drei bis fünf Wunschschulen gefragt, dann werden per Computer verschiedene Zuteilungen so lange abgeglichen, bis unter Berücksichtigung von Vorgaben wie Quoten, Geschwistervorzug und Wohnortnähe für jedes Kind die jeweils bestmögliche Variante herauskommt – und nicht nur für ein paar, deren Eltern es sich richten konnten.
In der Bildungsdirektion Wien, laut der heuer 20.600 in Wien gemeldete Kinder schulpflichtig werden, vertraut man auf das jetzige System. Es habe sich "angesichts der Erfüllung von 95 Prozent der Erstwünsche in hohem Maße bewährt".

Allerdings, merken Zednik und Greiner an, sind die Elternwünsche, die jetzt bei der Bildungsdirektion landen, nicht notwendigerweise die "wahren" Wunschschulen der Eltern, sondern bereits von vielen Überlegungen und Unsicherheiten der Eltern geprägt: Habe ich denn Chancen, in meiner Lieblingsschule einen Platz für mein Kind zu bekommen, oder ist es besser, ich nenne eine andere Schule, die näher liegt?
Privatschulen als "Pull-Faktor"
DER STANDARD fragte die Bildungsdirektion nach Nebeneffekten der Schulwahl ohne Sprengelvorgabe – ob es dadurch etwa mehr soziale Segregation in den Volksschulen gebe als im jeweiligen Wohnbezirk? Die Bildungsdirektion verwies auf die gesetzlichen Vorgaben (Geschwisterregel, Wohnortnähe und Schulwegsicherheit), betonte aber auch: "Stadtteilbedingte soziale Phänomene kann die Bildungsdirektion nicht ausblenden, sie werden mitberücksichtigt. In diesem Zusammenhang soll aber auch auf die international völlig unübliche frühe Segregation zu den Schultypen der Sekundarstufe I hingewiesen werden. Einen Pull-Faktor für bildungsaffine Familien stellen Privatschulen dar! Allerdings ist uns bekannt, dass ,Nebenwohnsitze‘ oder Anmeldung bei der Oma etc. vereinzelt vorkommen."
Das ist auch Karl Dwulit bekannt. Der Vorsitzende der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen in Wien bestreitet das Thema Scheinmeldungen gar nicht, lenkt im STANDARD-Gespräch den Fokus aber auf das Problem hinter den, wie er sie nennt, "Zirkelwanderungen". Zwar regiert da mittlerweile Google Maps, aber wenn’s eng wird, kommt es noch immer auf ein Haus näher oder weiter entfernt an: "Da gibt’s wirklich Schmankerl im negativen Sinn, wo Kinder nicht in die Schule gehen sollen, weil sie auf der falschen Straßenseite wohnen", berichtet Dwulit: "Dieses ,Wer wohnt ein paar Meter näher?‘ ist beschämend. Vielmehr sollten wir hinsehen, warum einige Schulen so einen Zulauf haben und andere nicht."
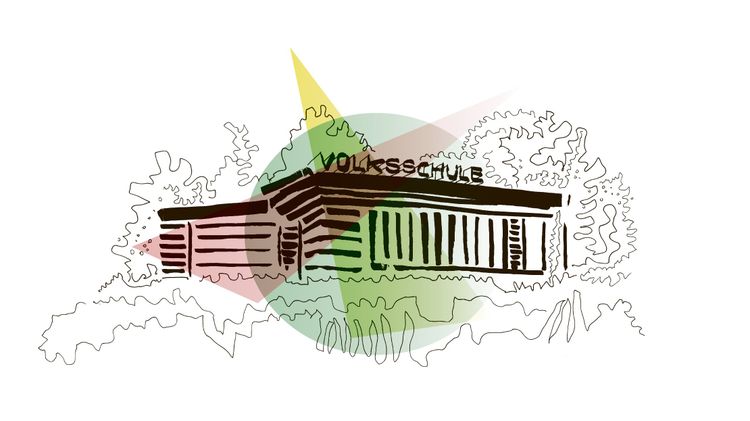
Jedes Kind sollte zählen
An sich werde der Elternverband mit dem Thema nicht sehr oft konfrontiert, "weil das meist sehr engagierte Eltern sind, die sich selbst zu helfen wissen. Das sind halt wieder fast nur bildungsnähere, sozioökonomisch bessergestellte Familien." Von der überschaubaren "Da müssen wir hin"-Gruppe, die beim Elternverband Hilfe sucht, sei ein Drittel "wirklich pädagogisch-didaktisch getrieben", die anderen haderten mit dem Wohnfaktor.
Dwulit wünscht sich ein Verfahren, das "den Fokus auf das Kind legt und bei der Schuleinschreibung auch Informationen aus dem Kindergarten besser nützt. Und natürlich ist die soziale Durchmischung wichtig. Gerade im Volksschulsektor ist die Nähe im Wohngrätzel wertvoll. Darum sollte man diesen Bruch ein bisschen sanfter gestalten." Also weiter Wahlmöglichkeit für die Eltern belassen, "aber darauf schauen, dass für alle eine passende Lösung gefunden wird, denn es geht um jedes Einzelschicksal." (Lisa Nimmervoll, 26.2.2022)